Oscarnominiert – dieses Attribut dürfte schon so manche Karriere in der Filmbranche beflügelt haben. Allein für den Preis in Betracht gezogen zu werden, kann als höhere Auszeichnung gelten als manch andere, gewonnene Trophäe. Die meisten der diesjährigen Nominierten für die beste Filmmusik müssen sich um ihre Karrieren allerdings keine Gedanken machen. John Williams hat den Oscar schon fünfmal gewonnen und dürfte seine 52. Nominierung gelassen zur Kenntnis nehmen; auch Alexandre Desplat wurde bereits mehrfach nominiert und zweimal ausgezeichnet. Randy Newman hat immerhin zwei Oscars für Filmsongs gewonnen. Sein Cousin Thomas Newman besitzt trotz diverser Nominierungen noch keine der goldenen Trophäen.
Einzig Hildur Guðnadóttir war für viele wohl noch ein wenig beschriebenes Blatt – zumindest bis sie für ihre Musik zu „Joker“ gleich mehrere Preise bis hin zum Golden Globe abräumte. Mit ihrem – nicht unwahrscheinlichen – Sieg würde der Oscar nach dem letztjährigen Sieger Ludwig Göransson erneut an eine Vertreterin der Nordischen Länder gehen.

„Joker“ (Hildur Guðnadóttir)
Ein Schurke mit verwischter Clownsschminke im Gesicht, ein Widersacher des Superhelden Batman. Doch Todd Phillips‘ „Joker“-Verfilmung ist keine gewöhnliche Comic-Blockbusterkost. Eher eine delikate und verstörende Mischung aus Hollywood und Arthaus. Düster, dreckig, schonungslos. Der Film erzählt, wie aus dem gedemütigten und offensichtlich psychisch kranken Arthur Fleck der Joker wird. Die Isländerin Hildur Guðnadóttir hat dazu eine kongeniale, perfekt dosierte Musik geschrieben. Beim bloßen Hören, mit dem Film im Hinterkopf, kann der Score schon mal etwas mager klingen – im Sinne von „da fehlt doch was“. Im Film aber geht die Musik eine fulminante Symbiose mit der Story und ihren Bildern ein. Und letztlich macht das einen guten Score aus: dass er im Zusammenspiel mit den anderen Komponenten des Films funktioniert.
Eine trostlose Stimmung durchzieht die Musik, passend zu der dystopischen Filmwelt, in der menschliche Wärme Mangelware ist. Die Hauptrolle spielt das Cello, mal sachte, ohne Vibrato gestrichen, mal metallisch, mal kratzig gebürstet. Zwei Themenkonturen gibt die studierte Cellistin Guðnadóttir ihrem Instrument, die sich jedoch eher ermattet dahinschleppen. Strahlende Helden gibt es in diesem Film sowieso nicht. Also auch kein Heldenthema. Stattdessen dissonante Reibungen und Beklemmung – und mit dem Track „Young Penny“ einen seltenen, sensiblen Ruhepol. Das alles schafft Guðnadóttir mit reduzierten Mitteln; viele Noten braucht es oft gar nicht. Geschickt kombiniert sie instrumentale mit elektronischen Klängen, schichtet, mischt und verfremdet den Orchesterklang und gibt dem Score so seinen besonderen Sound.
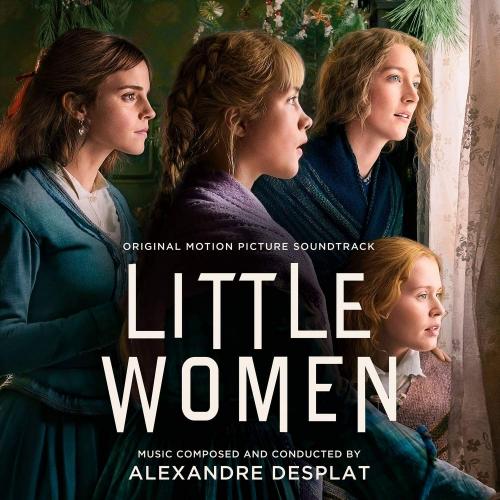
„Little Women“ (Alexandre Desplat)
Nach „Ladybird“ hat sich Greta Gerwig für ihren neuen Film eine literarische Vorlage von Louisa May Alcott vorgenommen. Im raffinierten Wechsel zweier Zeitebenen erzählt „Little Women“ von der Jugend der vier March-Schwestern Mitte des 19. Jahrhunderts in Massachusetts. Alexandre Desplat steuert dazu einen lichten und empathischen Score bei. Vorwiegend mit Streichern und Klavier, ab und zu treten ein paar Holzbläser und die Harfe dazu. Ein unbeschwertes Thema im Dreiertakt (etwa in „The Beach“), butterweiche bis elegant glitzernde Arrangements, dazu ein paar unerwartete Akkordwechsel – Desplat versteht es, sowohl die Stimmungen des Films zu unterstützen als auch eigene Akzente zu setzen. Im letzten Track packt er noch einmal die ganz große Romantikkeule aus – natürlich mit einer Prise Meta-Ironie, wie man am Ende des Films merkt.
Auch losgelöst vom Film funktioniert der Score wunderbar. In Passagen, die im Film etwas untergehen oder wenig auffallen, lässt sich oft noch ein kleines Detail, eine interessante melodische Wendung entdecken. Und schon die optimistische Eingangsmusik wirkt als Ouvertüre zum Album mindestens genauso gut wie im Film.
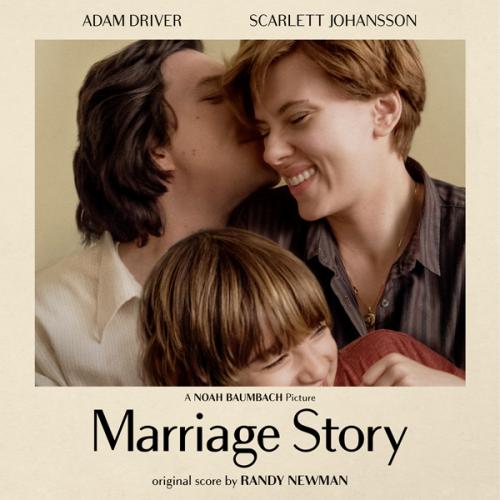
„Marriage Story“ (Randy Newman)
Eine Ehe geht zu Ende: Nicole und Charlie haben einen achtjährigen Sohn und arbeiten gemeinsam in einer Theaterkompanie in New York. Doch Nicole hat das Gefühl, immer hinter ihrem Mann zurückstehen zu müssen. Nun möchte sie ihre eigene Schauspielkarriere vorantreiben und zieht mit ihrem Sohn zu ihrer Familie nach Los Angeles. Die Netflix-Produktion des Regisseurs Noah Baumbachs lebt ebenso von ihren Dialogen wie vom außergewöhnlichen Spiel von Scarlett Johansson und Adam Driver.
Die Musik von Randy Newman spielt – rein auf die Laufzeit bezogen – eine kleine Rolle. Es ist der kompakteste Score unter den Nominierten, und zugleich der auffälligste: Wenn die Musik da ist, dann nimmt man sie auch wahr. Newman hat eine sanfte, herzerwärmende Musik für Kammerorchester komponiert. Mit Melodien wie aus einer fernen, heilen Welt, wie Erinnerungen an glücklichere Zeiten, oft lieblich wie ein Wiegenlied. Dabei unterstreicht die Musik gerade die warmherzige Seite der Figuren, den Teil Menschlichkeit und Liebe, der trotz heftiger Streitigkeiten nicht verloren geht. Vielleicht verdeutlicht sie die Erinnerung an die vergangene Liebe oder die gemeinsame Liebe zum Kind. Ein kleiner, feiner Feelgood-Soundtrack, der sich leicht losgelöst vom Film anhören lässt, weil er fast ausschließlich musikalisch angelegt scheint. Zwar sorgsam in den Film eingepasst, aber auch recht eigenständig.
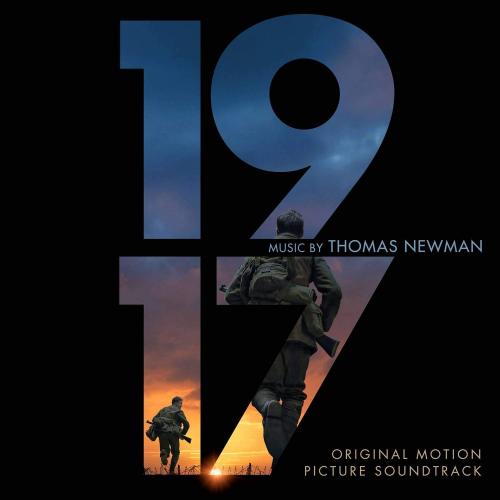
„1917“ (Thomas Newman)
Erster Weltkrieg, im britischen Sektor in Nordfrankreich. Die beiden jungen Soldaten Blake und Schofield werden beauftragt, eine wichtige Nachricht an einen Colonel zu übermitteln. Ihr Weg führt durch gefährliches Terrain. Regisseur Sam Mendes legt seinen Film als eine einzige (scheinbar) durchgehende Kameraeinstellung an und bindet dadurch das Publikum fest an die Protagonisten. Thomas Newmans Musik agiert häufig im Hintergrund und das ziemlich effektiv: Sei es in Form von unheilverkündenden Klangflächen oder in Spannungsmomenten, in denen auch die Musik die Nerven des Publikums auf die Zerreißprobe stellt. Wirklich interessant wird der Score, wenn er in den Vordergrund tritt: Mit dem Track „The Night Window“ geht die Musik eine herausragende Symbiose mit den Bildern ein. Wir sehen Schofield, der durch eine Ruinenlandschaft rennt. Eine morbid schöne Szenerie. Dazu ein Stück Musik wie in Trance, mit langgezogenen Akkorden und Auf- und Ab-Bewegungen in den Streichern, die immer wieder markant die kleine Sexte streifen.
Abseits dieser preisverdächtigen Szene streift der Score mit seiner Action-Percussion und den wabernden Sphärenklängen bisweilen die Grenze zum Blockbuster-Standard. Wirkungsvoll, aber auch schon oft gehört. Schade, denn gerade mit Blick auf das Regiekonzept hätte man auch bei der Musik unkonventionellere Wege gehen können. Oder sich zumindest den ein oder anderen unnötigen Bombast sparen.

„Star Wars: The Rise of Skywalker“ (John Williams)
Es ist sicher nicht der letzte „Star Wars“-Film, aber zumindest der neunte und letzte Teil der drei Trilogien umspannenden Skywalker-Saga. Alles läuft auf den Showdown zu und natürlich taucht der eine oder andere alte Bekannte wieder auf. Wie dem Film generell ein paar wirkliche Ruhepunkte gut getan hätten, so wäre auch bei der Musik ein bisschen weniger mehr gewesen. Klar, der Score funktioniert tadellos und lässt Freunde der klassischen Hollywood-Sinfonik immer wieder freudig aufmerken. Doch ist der Musikanteil wirklich enorm hoch – zu hoch. Dadurch wird mancher einzelne Musikeinsatz abgewertet; zumal, wenn virtuose Orchesterpassagen unter dem allgemeinen Soundgetümmel verblassen. Auch mit dem Wiederaufgreifen alter Themen übertreibt es Williams manchmal. Etwa wenn gegen Ende das Yoda-Thema erklingt, obwohl dieser weder anwesend ist noch auf ihn angespielt wird. Schade, weil Williams seine Motive sonst so sorgfältig an Bild und Inhalt anpasst.
Doch gerade wegen der Menge an Musik im Film lohnt es sich, einzelne Tracks nachzuhören: Zum Beispiel die Verfolgungsmusik „The Speeder Chase“. Oder „The Rise of Skywalker“, in dem zwei neue Themen präsentiert werden, inklusive einer wunderbar Williams-typischen Bläserchoralstelle (3:31).
Und, wer wird’s?
Alexandre Desplat hat erst 2018 den Oscar für „Shape of Water“ gewonnen – und damit für einen eingängigeren und klanglich individuelleren Score als nun bei „Little Women“. Randy Newmans „Marriage Story“-Musik ist vielleicht zu brav und unspektakulär für einen Oscar. Und Thomas Newmans „1917“-Score hat herausragende Momente, aber auch einen gewissen Standard-Faktor.
John Williams‘ „Star Wars“-Musik ist zwar alles andere als neuartig, aber sie ist in der heutigen Filmmusikwelt eine Ausnahmeerscheinung. Ganz auszuschließen ist ein Oscar daher nicht: Immerhin könnte die Jury damit den Kreis zum ebenfalls oscarprämierten ersten „Star Wars“-Film schließen – und zugleich den 88-jährigen Altmeister Williams indirekt für sein Lebenswerk ehren.
Noch wahrscheinlicher erscheint aber der Oscar für Hildur Guðnadóttir. Mit Blick auf das kongeniale Zusammenwirken von Bild und Musik in „Joker“ hätte sie ihn verdient. Und die Golden Globes haben immerhin schon das ein oder andere Mal spätere Oscargewinner vorausgedeutet.
Die Oscar-Verleihung 2020
Wer die Oscar-Verleihung in Los Angeles live mitverfolgen möchte, hat dazu die Gelegenheit: Auf ProSieben beginnt die Oscarnacht am 9. Februar ab 23:05 Uhr mit Berichten vom roten Teppich, wahlweise als Livestream im Netz oder im Fernsehen. Ab 2 Uhr morgens folgt dann die Preisverleihung.