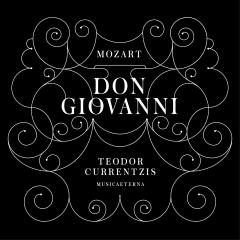Der Dirigent Teodor Currentzis polarisiert. Bei ihm rastet das Publikum aus. Leider wird mehr über seine Person gestritten als über seine Darbietung der Musik. Die einen wollen nach einem Konzert die Samtsessel aus den Halterungen rupfen und Currentzis damit erschlagen, die anderen liegen ihrem neuen Heilsbringer zu Füßen. Gruppe 1 stört sich vor allem an der Person Currentzis, samt Auftreten: Er dirigiert in Springerstiefeln, superskinny Röhrenjeans und flatternd-pechschwarzem Seidenhemd. Gruppe 2 verfällt dem Maestro mit all seinen Atti- und Plattitüden und ist blind vor Liebe. Die Trennung in Für und Wider verlangt ein Nachdenken über das Phänomen Currentzis und einen sehr genauen Blick auf die Musik. Schon bevor die letzte Aufnahme der Trias erschienen ist, war die Erwartungshaltung von beiden Lagern so groß, dass man sich von den Vorurteilen befreien muss, damit man überhaupt hinhören kann.
Der Mensch ist für Geschichten anfällig. Und im Naturell Currentzis scheint eine Geschichte par excellence angelegt: Ein Dirigent bricht seine Zelte mitten in Europa ab, genau dort, wo es alle jungen Musiker hinzieht. Es dürstet ihn nach Abgeschiedenheit. Die findet er in seinem selbst gewählten Exil im Uralvorland, mehr als eintausend Kilometer von Moskau entfernt. Dort, in Perm, hat er sich eine Art Kunstopernkloster geschaffen und kann scheinbar fernab des Großstadtlärms und der klassikübersättigten Zivilisation sich der Kunst so widmen, wie sie es braucht. So wird es sich zumindest erzählt.
Mit seiner Orchestermannschaft MusicAeterna – fast alle aus dem östlichen Teil Europas bis auf wenige Spitzenfreelancer, die vor allem das Holzregister besetzen – kann er dort nach seinen Regeln werkeln. Die Proben sind viel länger, als es ein Orchester in Deutschland tolerieren würde, und ziehen sich oft bis in die frühen Morgenstunden. Wenn einer meckert, wird kurzer Prozess gemacht und er fliegt raus. Das, was die Musiker dort verdienen, ist ebenfalls nicht der hiesige Standard, dennoch pilgern sie zu ihm. Warum? Die Musiker erhalten dort etwa, so sagen es einige zumindest, was sie hier nicht bekommen: einen Dirigenten, der macht, was er will, wann er will, wie er es will, und dies würde sich im künstlerischen Produkt niederschlagen. Er führe sie über ihre Grenzen hinaus. Der sektenartige Community-Aspekt tut das Übrige: Es wird von Aufnahmesessions bei Kerzenschein, exzessiven Saufgelagen und andächtigen Proben berichtet.
Nach einer solch sagenumwobenen Geschichte lecken sich die Vermarkter großer Labels die Finger. Die Marketing-Geschütze irritieren also nicht: Der gesamte Zyklus aller drei Mozart-Opern, zu denen Lorenzo da Ponte das Libretto 118 schrieb, erhält einen künstlerisch aufwendigst produzierten Trailer. Aber auch jede der drei Opern einzeln, „Le nozze di Figaro“ (2014), „Così fan tutte“ (2015) und „Don Giovanni“ (2016) werden mit eigenen künstlerischen Kurzfilmen beworben. Die CDs kommen in Buchform, mit durchschnittlich 250 Seiten Booklet, mit einem harten Cover und aufwendigem Design. Currentzis hat alle drei Opern im Studio aufgenommen, was heutzutage aufgrund der immensen Kosten immer seltener wird. Die Postproduktion schlägt nochmals zu Buche: Er dreht Arien minimal schneller, mischt ab, als gäbe es kein Morgen mehr, und beschäftigt sich während der Produktion mehrere Stunden mit nur einer Arie.
Bizets Carmen, Verdis La traviata. Die berühmten Opern nennen wir in einem Atemzug mit ihren Komponisten. Aber wer schrieb eigentlich das Textbuch, das sogenannte Libretto, dazu? Von den Librettisten sind heute nur wenige Große geläufig, wie zum Beispiel Mozarts Textdichter Lorenzo da Ponte. Ausnahme: das Multitalent Richard Wagner. Der dichtete die Texte zu seinen Opern selbst. (AJ) ↩
„Le nozze di Figaro“, „Così fan tutte“ und „Don Giovanni“ – die perfekte Symbiose zwischen Wort und Ton
Was für eine Wandlung! In den folgenden Musikbeispielen kann man hörend nachvollziehen, wie sich die Aufführungstradition im letzten halben Jahrhundert verändert hat:
Moderates Tempo, gleichbleibender Duktus und Unaufgeregtheit: Herbert von Karajan und das Philharmonia Orchestra haben es 1954 ruhig angehen lassen. Die Dynamik verändert sich über mehrere Takte, Ausbrüche gibt es kaum. Karajan wird noch immer verehrt, er war derjenige, der als erster Künstler die klassische Musik in den Pop-Olymp katapultierte und bereits zu Lebzeiten alles daran setzte, seine Zeit zu überdauern. Diese Aufnahme ist das beste Beispiel, dass vor allem sein Jet-Set-Leben und Kommerzialisierungsbestreben überleben werden, weniger die Musik.
In der gleichen Tradition bewegt sich Karl Böhm, jedoch etwas präzisier. Das könnte auch am Tempo liegen, das die Wiener Philharmoniker an den Tag legen. Zwar ist die Einspielung von 1974 sehr durchsichtig, hat jedoch auch Reliquiencharakter. In den abwechselnden Läufen im Holzregister wird das Tempo wie ein Kaugummi verlahmt, dass man denkt, der arme Mozart käme gleich zum Erliegen. Schwerpunkt lag zur damaligen Zeit auf dem romantischen Repertoire. Böhm wurde Ende des 19. Jahrhunderts geboren.
Einschneidende Veränderung in der Aufführungstradition versprach die sogenannte historische Aufführungspraxis, die ihre Wurzeln schon im frühen 20. Jahrhundert hat. Zur ersten breitenwirksam populären Generation zählt Nikolaus Harnoncourt. Nun ist das Royal Concertgebouw Orchestra kein historisches Ensemble, aber der Duktus der Aufführung verändert sich: Die Besetzung wird ausgedünnt und Harnoncourt beginnt sich in Quellenrecherche den Spielanweisungen zu Mozarts Zeiten anzunähern, wissend, dass es keine letztgültigen Wahrheiten gibt.
Schneidend, trocken und blechern! René Jacobs und Concerto Köln legen eine Mozarteinspielung vor, die vor Frische, Energie und unentwegtem Drängen strotzt. Jacobs war 1999 auch einer der Ersten, die die Rezitative sehr frei gestalteten. Die dramaturgischen Linien der Musik werden kleinteiliger genommen, es gibt mehr spontan wirkende Veränderungen in der Musik, die das Geschehen aufmischen.
Dass sich Teodor Currentzis eher in die Schachtel des historisch informierten Spiels stecken lässt, hört man sofort. Schnelle, zackige und fast schon abgehackte Akkorde brechen über das Ohr herein. MusicAeterna ist kein Spezialensemble für die historisch informierte Aufführungspraxis, aber scheinbar ist die Zeit gekommen, nicht das Für und Wider dieser Spieltechnik weiter abzuspulen, sondern diese als einen etablierten Stil zu sehen. Currentzis dirigiert, wie er will.
„Così fan tutte“ ist das Herzstück der Trilogie. Currentzis kann dort glänzen, wie bisher in keiner seiner Aufnahmen. Die Besetzung ist phänomenal: Anna Kasyan als kichernd-kecke Despina, die durch ihre Stimmspielereien eine Bühne gar nicht braucht, um den Witz ihrer Rolle zu vermitteln. Simone Kermes (Fiordiligi) und Malena Ernman (Dorabella) schaffen in ihren Arien Momente, in denen die Zeit stillsteht, und Christopher Maltman (Guglielmo) und Kenneth Tarver (Ferrando) scheinen mit der übergestülpten Verkleidung auch die Stimmen gewechselt zu haben. Die vier Querverliebten singen in der mit Quartetten bestückten Oper alle in einer Reihe gleichberechtigt, der Puls der Mozartschen Musik treibt das Ensemble an, so dass man am Ende wahrlich nicht mehr weiß, ob betrügen nicht der beste Weg ist, wenn es sich so bittersüß anhört. In allen drei Opern besticht zudem der Cembalist Maxim Emelyanychev, der die Rezitative derart kreativ improvisiert, aus dem bestehenden Opernmaterial zitierend. Er ist es, der den handlungstreibenden Rezitativen 109 Lebendigkeit schenkt, die man so viel zu selten hören kann.
Bei „Le nozze di Figaro“ zieht Mary-Ellen Nesi als Cherubino bedauerlicherweise die Qualität der ganzen Aufnahme nach unten. Sobald sie in die mittlere Lautstärke wechselt, sticht ihre Stimme bereits scharf hervor. Erreicht Nesi kräftige Höhen, kracht und scheppert sie. Simone Kermes als Gräfin Almaviva rettet erst mit dem Wendepunkt der Oper ihre Partie, weil Currentzis´ Wunsch, auf ihr Vibrato zu verzichten, sonst nicht gelingt. Aber nachdem Andrei Bondarenko, der geläuterte Graf, aus dem Nichts zur Entschuldigung „Contessa, perdono“ anhebt und Kermes einstimmt, als sei das Übel der Menschheitsgeschichte vergessen, will man ihr alles verzeihen. Diese Momente kostet Currentzis wie kein anderer aus, ja, er scheint sich in diese besonderen Momente festzubeißen und nicht loszulassen, bevor er sie nicht perfekt hinbekommt.
Im „Don Giovanni“ potenziert er diese Extreme, die bei Mozart bereits angelegt sind, bis ultimo. Gerade in den letzten Arien der Beteiligten wird man von einer äußersten Emotion in die nächste geworfen. Die Besetzung ist die schwächste der Einspielungen, insbesondere die Männerstimmen. Ein unbeweglich-farbloser Don Giovanni (Dimitris Tiliakos) und zu durchdringender Don Ottavio (Kenneth Tarver) werden nur von Leporello (Vito Priante) gerettet, der alles zu können scheint: knistern, sehnen, leiden und strahlen. Karina Gauvin ist eine Parade-Donna-Elvira, sie ist der Inbegriff der Eifersucht, fährt schneidig dazwischen und donnert ihren Verflossenen mit Gewalt gegen die Wand. Die einzig wirklich süßen Töne stimmt Myrtò Papatanasiu (Donna Anna) an, ihr fabelhaft zarter Sopran schafft die leisesten Stellen in höchster Höhe.
Diese vornehme Schwester des Rap ist eine Art melodisch und rhythmisch notierter Sprechgesang, begleitet entweder von einer kleinen Instrumentengruppe aus Cembalo und Bassinstrumenten (Secco-Rezitativ) oder dem Orchester (Accompagnato-Rezitativ). Anders als in der Arie, wo die Figuren ausgiebig in ihren Gefühlen schwelgen, treibt es die Handlung voran. (AJ) ↩

Es ist ein Zyklus, über den wir uns freuen sollten! Sieht man Currentzis als eine zusätzliche Farbe in der bisherigen Diskografie, wird diese Aufnahme unser Hören auch der anderen Einspielungen verändern, die ihre Ruhe und Gelassenheit erst durch den eckig-kantigen und teils überdrehten Stil von MusicAeterna atmen können. Dass über dieses Mozart-Projekt so gesprochen und geschrieben wird, als sei Currentzis David Garrett und würde Mozart mit Elektro-Beats unterlegen und zerhackstückseln, ist seinem Auftreten geschuldet. Natürlich riecht ein inszenierter Apostel der Kunst, der an den Sockeln der großen Platten-Meistern mit Hammer und Meißel ansetzt, nach Anti-Establishment. Vielleicht ist Currentzis sogar ein kleiner Populist, der beklatscht wird, weil er Mozart überdreht und teilweise gegen den Strich bürstet. Damit wickelt er große Teile seines Publikums um den Finger. Die Conclusio ist vielleicht langweilig, aber: Currentzis hat eine überdurchschnittliche Aufnahme produziert, die wie alle anderen in dieser Riege auch, Tücken und Stolpersteine besitzt. Ein Phänomen wie Currentzis erscheint nicht einfach so. Es braucht vorher eine Nachfrage. Und die wird immer gegeben sein, denn seit es Kunst in unterschiedlichen Strömungen gibt, herrscht ein Kampf der jeweiligen Anhänger um den jeweils „richtigen Weg". Reicht es da auch, wenn man sich nur als Mozartanhänger bezeichnet?
© Ruhrtriennale